
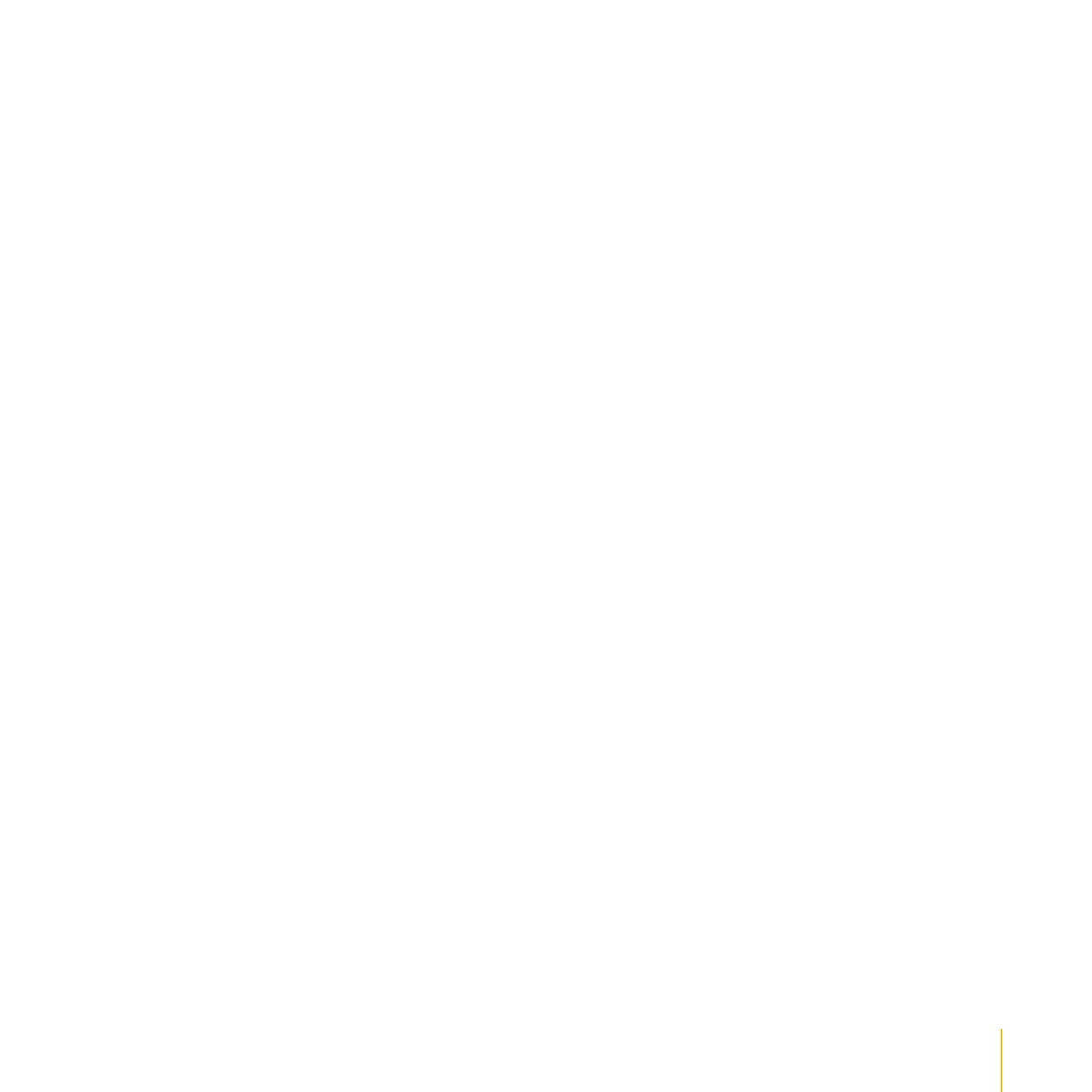
Als Brahms 1866 mit einem Schuss Gelassenheit ankündigt, das er soeben
sechzehn kleine, harmlose Walzer in Schubertform komponiert habe,
bringt ihr
Widmungsempfänger, der Wiener Kritiker Edvard Hanslick, das allgemeine
herrschende Erstaunenwie folgt zumAusdruck:
Brahms undWalzer! Die beiden
Worte stehen sich auf der elegantenTitelseite völlig verblüfft gegenüber. Brahms, der
Ernste,derSchweigsame,derwahrekleineBruderSchumanns,sollWalzergeschrieben
haben!Unddas,woerdochsonordisch,soprotestantischundauchsowenigweltlichist!
Die
Sechzehn Walzer
(Opus 39) sind, versteht sich, keine Tanzmusik – und
Hanslick lässt sich da auch nicht nicht täuschen, aber sie bringen nochmals
die Lust an der Variation zum Ausdruck, selbst wenn dies hier auf völlig
andere Art geschieht: Vom schwerfälligenWalzer der Hamburger Cafés über
den bayrischen Ländler oder das Leuchten des magyarischen Cymbaloms
bis zum überschäumenden Wiener Walzer, mal Strauss, mal Chopin, mal
Schumann, mal Schubert beschwörend, ist alles dabei und alles ist zutiefst
persönlich. Ursprünglich 1866 für Klavier vierhändig komponiert (manche
sogar bereits ab 1856) hatten diese Walzer einen dermaßen großen Erfolg,
dass Brahms sich sofort daranmachte, eine Version für das zweihändige
Spiel zu erstellen.
Obwohl es zwischen den Stücken keine Verbindung gibt, bilden
sie doch aufgrund der Kombination und Abfolge von Tonarten,
Tempi und rhythmischen Formeln ein bemerkenswert kohärentes
Gesamtgebilde. Die Walzer besitzen vor allem den Duft der ersten
Kindheitserinnerungen, die man wiederfindet – einer Kindheit, die
sich viel in Weinlokalen abspielte, wohin es den Musikervater zu
begleiten galt.
113
GEOFFROY COUTEAU

















