
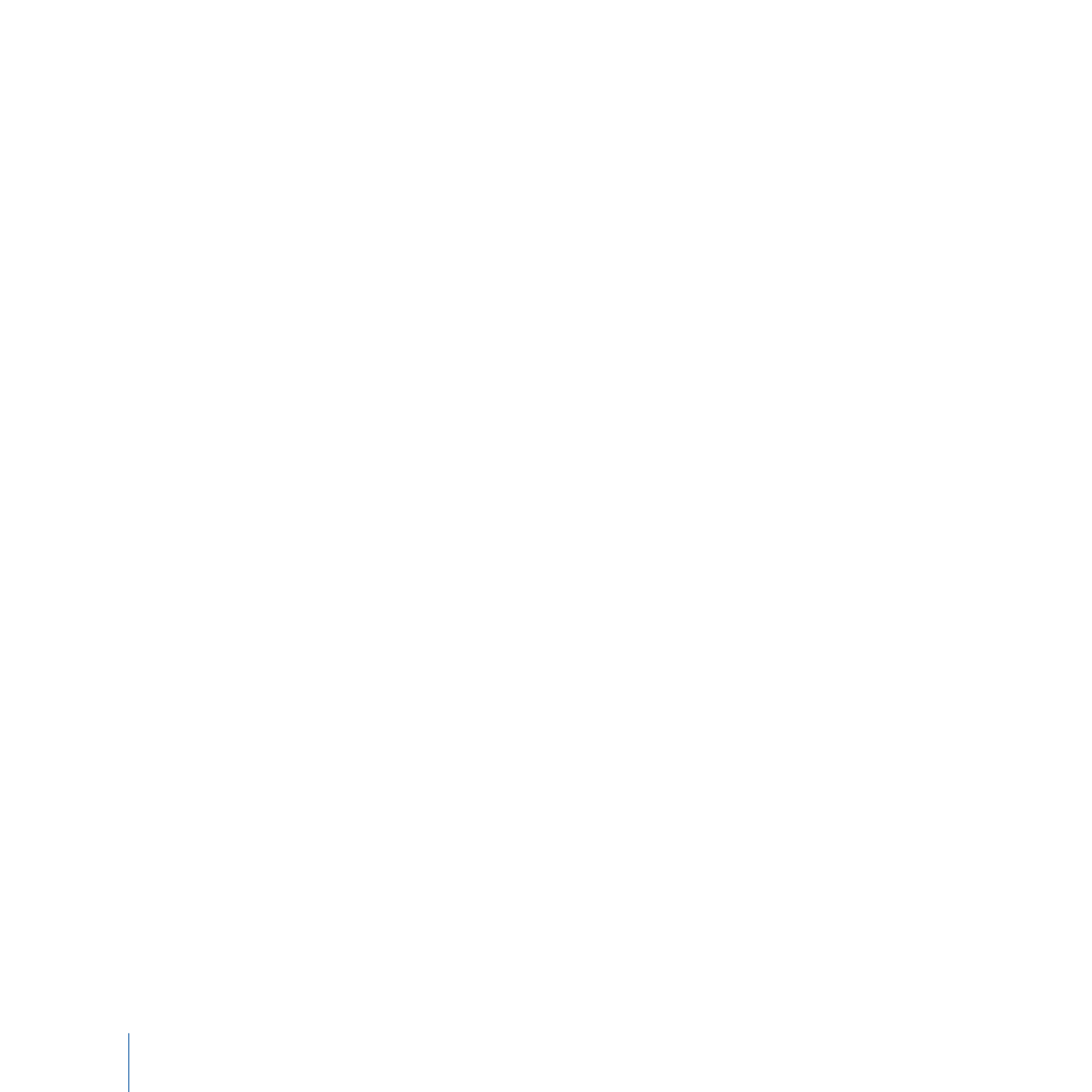
MOZART_QUATUOR TALICH
58
K
ann man Mozart denn tadeln, wenn er sich bei der Komposition
eines ersten von seinem Vater Leopold beiläufig so genannten
„Quatro“ zerstreut? Mozart ist gerade mal vierzehn Jahre alt und,
wie sein Vater sagt, vertreibt sich die Zeit in den schwankenden
Postkutschenauf demWeg vonMailandnachBologna. Hat er schon
ein Streichquartett von Giuseppe Sammartini (1695-1750) gehört?
Von 1770 bis 1773 entstehen dreizehn Stückchen, „Quatri“, in Anlehnung an
den italienischen Stil. Die so genannten Mailänder Streichquartette sind ei-
gentlich nichts! Aber stimmt das wirklich? Denn nicht jedermann kann wie
der junge Mozart so mit gewagten Modulationen spielen und ohne Furcht
vor Tadel mit kühnen Chromatiken experimentieren. Die ersten Streichquar-
tette schaffen Selbstvertrauen beim Notenschreiben; das Räderwerk muss
gut eingestellt werden. Ihre Komposition mit regelmäßigen Intervallen in
drei Sätzen verdienen es immer weniger, nur mit zerstreutem Ohr gehört zu
werden.
Bei seiner Ankunft in Wien 1773 kennt Mozart wahrscheinlich Opus 17 und
20 von Haydn. Erst viel später wird er dem Mann begegnen, der seit zwei
Jahrzehnten ein neues Genre, das „Wiener Streichquartett“, schafft.
Er ist 17 Jahre alt, blickt dem 40 Jahre alten Meister Haydn beimNotenschrei-
ben über die Schulter und lässt sich davon inspirieren. Offen gestanden, er ko-
piert ihn nach Art eines Handwerkers, und man muss gerechterweise sagen,
dass die Reproduktion nicht leicht fällt. Also werden die sechs so genannten
„Wiener Streichquartette“ (KV 168 bis KV 173) aus vier Sätzen bestehen. Die
Partitionen wirken manchmal etwas unausgeglichen; in der Mischung von
entlehnten Passagen mit spontanen, doch noch nicht ganz fertigen Anläu-
fen ist die Suche nach dem eigenen Stil spürbar. Mozart, innerlich noch zu

















